
Midifizierung einer Böhm FnT Orgel |
|
keine Angst, es folgt kein Midi Lehrgang, nur das Wichtigste
(dürfte dem Interessenten an diese Thema ohnehin bekannt sein).
Midi
ist die Abkürzung für Musical Ins+trument
Digital Interface, auf Deutsch also Schnittstelle für
Musikinstrumente. Es ist eigentlich eine Computersprache mit deren Hilfe
elektronische (seit neuestem auch mechanische Musikinstrumente wie Gitarren, Flöten,
Schlagzeug etc.) miteinander oder mit einem Computer kommunizieren können.
Auch lassen sich so Expander (Soundmodule) oder Lichtsteuergeräte mittels
Midi ansprechen. Der Vorteil liegt auf der Hand: unterschiedliche Hersteller
von Musikinstrumenten haben eine gemeinsame, standardisierte "Sprache".
Ein Beispiel für einen Midi Befehl ist der Notenbefehl
(Note-Message). Wenn man einen Ton auf der Tastatur eines Midi Keyboards spielt,
wird diese in einen binären Code (das ist das mit den Nullen und Einsen) übersetzt.
Dieses Signal beinhaltet die Tonhöhe (Lage auf der Klaviatur), die Ton
Dauer (On/Off) und die Ton Intensität (leiser oder lauter Anschlag). Das
Signal wird dann an die Midi-Out Buchse geleitet. Von hier aus gelangt das
Signal über die Midi-In Buchsen zu den angeschlossenen Geräten. Dieses
Gerät, z.B. ein Soundmodul, spielt den gedrückten Ton. Über
weitere Midi Befehle (Controller-Befehle) lassen sich so umfangreiche
Musikanlagen zu unterschiedlichen Zeiten ansprechen. Der Musiker (sprich hier:
ein Musiker) ist somit in der Lage, allein ein ganzes Instrumenten-Orchester zu
befehlen.
Mit Hilfe von Computern und einer Sequencer Software kann
ein Musiker, wie zu Zeiten der alten Mehrspur-Tonbandtechnik, aufwendige
Musikarrangement erstellen, bearbeiten und aufzeichen.
Teil A - 2. Technische Umsetzung
in einer 3 manualigen Böhm Orgel Typ FnT
Die Böhm Orgeln der nT Serie verwenden einen
elektronischen Tonerzeuger, den sog. Generator. Dieser Generator erzeugt
permanent Sägezahnschwingungen (bzw. Rechteckschwingungen). Also alle Töne
der Orgel von C (Unterstrich) bis c6, rund 9 Oktaven. Diese elektrischen
Signale werden über Kabel an die Tastenkontakte weitergeleitet. Die
Tastenkontakte sind nichts weiter als Umschalter Ein/Aus. Unter jeder Taste ist
also ein 9facher Umschalter vorhanden. In der Skizze weiter unten "prinzipieller
Aufbau der 3 Manuale", als Kontaktplatte bezeichnet. Von diesen Schaltern
gelangt das Signal bei gedrückter Taste an die Klangformung (Register),
wird hier über RC, LC, Widerstandsketten solange umgeformt, bis eine
Schwingungsform entsteht, die dem des gewünschten Instrument (bei gedrücktem
Register) entspricht, beispielsweise ein Principal 8`. Das Ganze ist also eine
analoge elekronische Klangerzeugung.
Die Entwickler des Instruments
haben jetzt nicht nur die 9fachen Umschalter pro Taste konzeptioniert, sondern
vielmehr einen weiteren Umschalter vorgesehen. Dieser Umschalter war zum Anschluß
von Erweiterungen wie des Böhmaten (elektronische Begleitautomatik),
vorgesehen. Weiter soll hier nicht auf die Analog-Orgeltechnik eingegangen
werden.
Sofern, Sie, lieber Interessent, Ihre Böhm Orgel nicht mit
diesen Erweiterungen ergänzt haben, hat Ihre Orgel in der Regel also im
Pedal, Untermanual und Mittelmanual je Taste einen Umschaltkontakt frei. An
diese freien Umschaltkontakte lassen sich die Midi-Nachrüstungen ganz
einfach anschließen.
Sofern Sie die Ergänzungen eingebaut
haben, bleibt Ihnen die Wahl zwischen a) Rückbau (nicht zu empfehlen) oder
Nachrüstung von Umschaltkontakten je Taste. Etwas aufwendig, aber das
Ergebnis ist die Mühe wert.
Die folgende Skizze zeigt den
prinzipiellen Aufbau der 3 Manuale mit den Umschaltern (Kontaktplatten) und möglichen
freien Kontakten

Sofern Sie die Nachrüstungen in Ihrer Orgel
haben, müssen Sie die Umschalter pro Taste nachrüsten. Um es gleich
vorweg zu nehmen, eine Arbeit die etwas handwerkliches Geschick erfordert! Die
Kontaktwinkel (siehe nachfolgende Skizze) sind durch die Kunsstofftasten gegen
den Klaviaturrahmen (Masse der Orgel) isoliert. Prüfen Sie das zur
Sicherheit mit einem Ohmmeter. Das ist unser Glück. An diese Kontaktwinkel
lassen sich so mit etwas Geschick bewegliche Kontaktdrähte anbringen
(idealerweise die Originalkontaktdrähte von Böhm aus , aus der
Bastelkiste usw. usw.), wie in der Skizze eingezeichnet. Pro Oktave dient eine
Lochrasterplatine (ca. 1x1 cm) dann zur Aufnahme der Erdsammel- bzw. Signaldrähte.
Die Kontakt- und Stahldräthedrähte. Böhm
schrieb damals in der Bauanleitung von einem Federkern mit Spezial-Oberfläche
mit 0,35mm Duchmesser. Meine Recherechen bei diversen Herstellern ergaben, dass
man diese zwar bekommt, aber mit einer CU Oberfläche, was nach meinen Überlegungen
langfristig zu Kontaktproblemen führen kann. Oberflächen wie Silber
oder Phosphorbronze ( oder Berylliumkupfer ?) sind besser geieignet. Ich hatte
dann insofern ein wenig Glück, dass ich eine aufgebaute Böhm Klaviatur
bei e-bay ersteigern konnte. Diese hat als Quelle für die Kontaktdrähte
herhalten müssen. Die Stahldrähte habe ich vor dem Einbau gründlich
mit Sandpapier gereinigt (kein Kontaktspray o.ä.).
Seit mehr als einem
Jahr sind bislang keine Probleme aufgetreten
Auf die Funktion und den Anschluß wird im nächsten
Kapitel Midi-Nachrüstung noch eingegangen.
Meine Ausführung
zeigt das Foto weiter unten. Die Erdsammel- bzw. Signaldrähte bestehen aus
1,5 mm Stahldrähten, in der Länge für das gesamte Manual
angepasst. Man kann sie in jedem Modellbaugeschäft bekommen. Die Stahldrähte
sollten vor dem Einbau gereinigt werden. Bitte achten Sie darauf, dass der
Einbau der Lochrasterplatinen so erfolgt, dass bei gedrückter Taste noch
1-2 mm Luft zwischen Kontaktwinkel und Lochrasterplatine ist (in der Skizze mit
Weg A bezeichnet). Lieber Leser, pro Manual 61 Kontaktdrähte wie
beschrieben einbauen, das heißt 183 Kontaktdrähte, 5-6
Lochrasterplatinen, pro Manual, 6 Stahldrähte; im Pedal noch einmal für
30 Tasten, dazu braucht es etwas Zeit. Wenn Sie hier "unsauber"
arbeiten, werden Sie später beim Orgelspiel dafür "bestraft".
Nehmen Sie sich also Zeit. Die Stahldrähte habe ich an den Manualenden
links und rechts mit vom Kunsstoff befreiten Lüsterklemmen fixiert.
Vorteil: man kann in die Lüsterklemmen die Kabel zu den Midi Adaptern
anschließen, da man Stahl nur sehr schwierig löten kann.
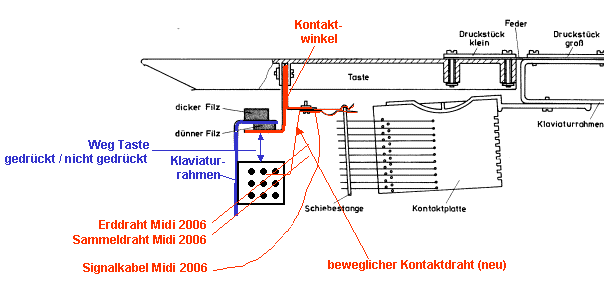

Wenn diese Arbeiten ausgeführt sind, müssen
die Kontaktdrähte noch justiert werden. Bei nicht gedrückter Taste
muss der bewegliche Kontaktdraht sicher am Erddraht anliegen, bei gedrückter
Taste muss der bewegliche Kontaktdraht sicher vom Erddraht abheben und am
Sammeldraht anliegen. Wenn Sie eine anschlagdynamische Midi Nachrüstung
(siehe nächstes Kapitel) wählen, ist diese Justierung Voraussetzung
dafür, dass die Anschlagdynamik über die gesamte Tastatur gleichmäßig
beim spielen wirkt. Jetzt können Sie sich dem Einbau der eigentlichen
Midi-Adapter widmen
Teil A - 3. Midi Adapter Nachrüstung
Midi Adapter werden von einigen Herstellern angeboten. Zum
einem von Böhm selbst in verschiedenen Ausführungsformen, sprich
anschlagdynamisch oder nicht. Weitere Hersteller findet man im Internet.
Auch
der Selbstbau ist für versierte Elektroniker möglich. Bauanleitungen
findet man im ebenfalls im Internet.
Für welchen Adapter Sie sich
entscheiden, ist für die Funktion belanglos.
Das Prinzip ist
einfach. Jeder Taste (beweglicher Kontaktdraht) ist ein Kontakt auf den
jeweiligen Adaptern zugeordnet, die Erd- bzw. Sammeldrähte als
Summensignal. Wenn man sich an die beiliegenden Beschreibungen hält, ist
der Zusammenbau, Einbau und elektrischer Anschluss einfach.
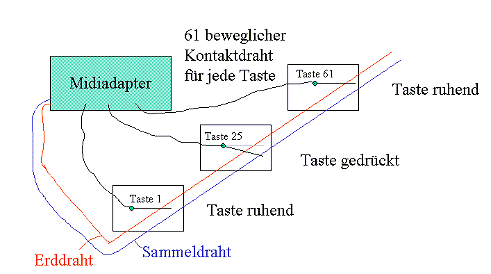
Meine Böhm FnT ist mit 3 Böhm Midi
Adaptern Typ 2006, anschlagdynmisch aufgerüstet worden. Die zwei
nachfolgenden Fotos zeigen deren Einbau im Mittelmanual.

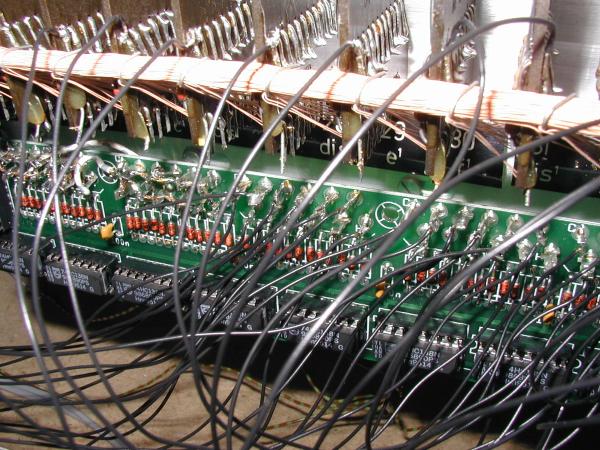
Teil A - 4. Midi "raus"
Ein
wenig Theorie. Jeder Midi-Adapter erzeugt ein Signal, welches zum Ansteuern von
Midi Empfängern wie Soundmodulen usw. geeignet ist. In der Regel hat jeder
Midi-Empfänger einen Midi-Eingang, so dass sich 3 Manuale und ein Pedal so
nicht anschließen lassen. Alternativ kann man jedem Midi-Adapter ein
eigenes Soundmodul spendieren (wer sich das leisten kann, bitte), elganter ist
dagegen die Zusammenführung der 4 Midi Adapter auf einen Midi Ausgang. Da
es sich um digitale Signale handelt, ist ein zusammenführen über
Widerstände leider nicht möglich.
Dazu gibt es geeigente
Technik, sog. Midi-Merger in den verschiedensten Ausführungsformen. Zur
komfortablen Verwaltung der 4 Midi-Adapter habe ich das Böhm Midi Control
eingesetzt, auf dessen Möglichkeiten im nächsten Kapitel eingegangen
wird. Die nachfolgende Skizze zeigt das Prinzip eines Midi-Mergers.
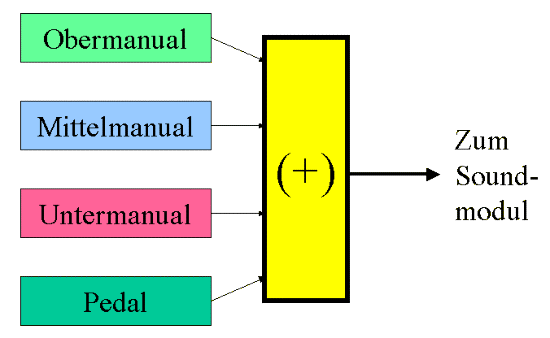
Teil A - 5. Böhm Midi Control
- Erweiterung auf 2 Bedienfelder
Ein Midi-Merger der
Luxuxklasse stellt das Böhm Midi-Control dar. Auch andere Hersteller
vertreiben Midi Merger in verschiedenen Qualitäten. Ich habe mich für
das Böhm Midi-Control entschieden, weil dieses Gerät fast keine Wünsche,
was mit dem Umgang mit Midi-Signalen machbar ist, offen lässt. Auf den
Umgang mit den Midi Signalen gehe ich im Teil B - Schnittstelle, Routing
und Progammierung noch detailliert ein.
Hardwaremäßig
bietet das Gerät die Möglichkeit 4 Midi-Eingänge, 4 Midi-Ausgänge
sowie ein externes Diskettenlaufwerk zur Datensicherung anzuschließen. Die
Bedieung und Programmierung ist über Tasten und Drehregler, nach einiger
Einarbeitungszeit, auch problemlos möglich. Ein zweizeilige Anzeige
vervollständigt das Ganze. Wer einen ATARI Computer sein eigen nennt, kann
die Progammierung komfortabel über den Computer am Bildschirm vornehmen.
Dazu ist ein eigener Editor notwendig.

In meinem konkreten Fall ergab sich jetzt die
Problematik, dass das Midi-Control einfach zu groß ist, um es irgendwo
links oder rechts neben den Manualen aufzustellen. Stellt man es oben auf die
Orgel, ist es einfach zu weit weg, also nicht mehr im kurzwegigen Zugriff für
die Hände während des Spielens. Also entschloß ich mich zu einem
weitreichenden Eingriff. Ich habe die Bedienelemente (18 Taster und 4
Drehregler) dupliziert und in die linken Seitenbrettchen am Mittel- und
Untermanual eingebaut. Wie das im noch nicht ganz vollendeten Ausbau dann
aussieht, zeigt das nachfolgende Foto.

Ich möchte in diesem Zusammenhang nicht auf
die Grundlagen der Elektrotechnik eingehen, was so alles zu beachten ist, beim
parallelschalten von Widerständen mit dem daraus resultierenden neuen
Gesamtwiderstand usw. usw., Das würde den Rahmen dieser Homepage sprengen.
Nur soviel sei gesagt, das Problem muß gelöst werden, um die Funktion
des Midi Control nicht zu gefährden. Mein Midi Control sollte auch
weiterhin als Stand-Alone Gerät verwendet werden können. Um das
sicherzustellen, habe ich an der Rückseite aus Paralell- und
Seriellbuchsen, wie sie aus der Computertechnik bekannt sind, eingebaut. Die zu
den Potis und anderen Bauelementen führenden Leitungen werden dazu auf der
Hauptplatine des Midi-Control getrennt und zu den Buchsen geführt. Ein
aufgesteckter "Blindstecker" schließt die Stromkreise wieder und
sichert somit den Stand-Alone Betrieb. Werden die Blindstecker abgezogen und mit
einem anderen Stecker verbunden, der die Bedienelemente-Verdrahtung von den
Seitenbrettchen aufnimmt, sind diese dann auch wirksam. Das Midi Control ist
somit bedienelementemäßig quasi in die FnT integriert. Das ganze
funktioniert einwandfrei. Während des spielens auf der Orgel hat man einen
einfachen, kurzwegigen Zugriff auf die Midi Steuerung.

Jetzt waren endlich alle hardwaremäßigen Vorbereitungen abgeschlossen. Die Orgel war damit midifiziert. Jetzt galt es nur noch das Midi-Control zu programmieren, um endlich die Möglichkeiten einer 3 manualigen Orgel mit Vollpedal mittels Midi auszuschöpfen. Wenn Sie Interesse haben, lade ich Sie ein, im nächsten Kapitel nachzulesen, wie ich meine Midi Orgel "geroutet" habe.
Hinweis: die schwarz-weiss Skizzen stammen aus der Bauanleitung der Fa. Böhm, von mir um die erweiterungsrelevanten Einbauten farbig ergänzt
Teil B - Schnittstelle, Routing und
Progammierung
© Christoph Pollag, erstellt: 26.01.2004, update 23.05.2008